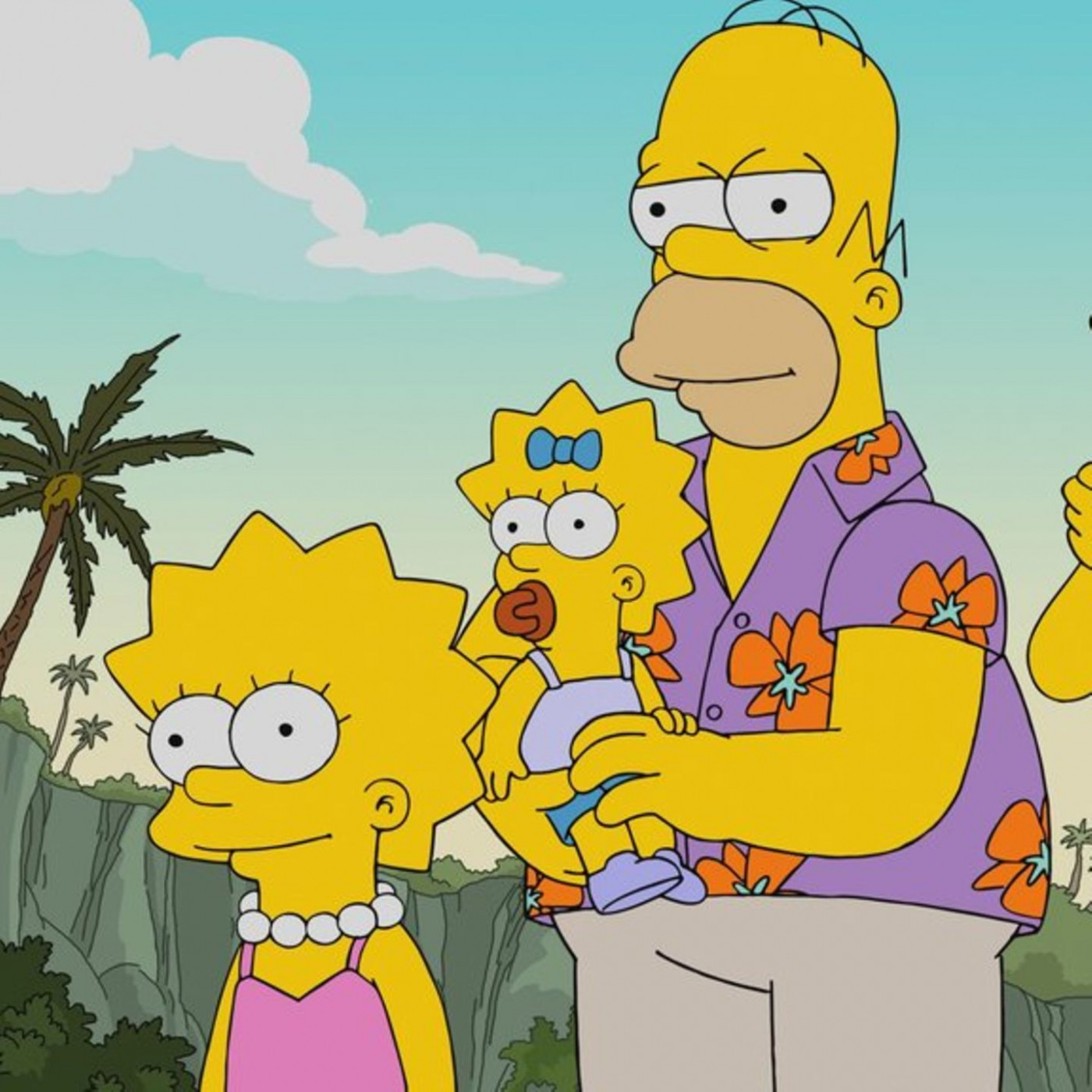Inklusivität in der Kunst – ein grosses Wort, aber wie oft wird sie gelebt? Susanne Kunz stellt sich dieser Herausforderung und leitet einen Chor, in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam singen. Sie fordert, überfordert – und lernt sich selbst dabei neu kennen. Ein Gespräch über Mut, Scheitern und echte Verbindungen.
SRF: Was bedeutet die Zusammenarbeit mit beeinträchtigten Menschen für Sie persönlich?
Susanne Kunz: Ich mag Menschen, die man nicht auf den ersten Blick einschätzen kann. Ich mag Diversität. Leider hat man im Alltag selten Kontakt zu Menschen mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung, es sei denn, sie seien Teil des näheren Umfelds. Die Inklusion, von der oft gesprochen wird, findet in meiner Welt nicht wirklich statt. Daher war es spannend, mich bei diesem Projekt selbst zu beobachten. Als Coach musste ich lernen, abzuwägen, wie viel ich fordern kann. Mir war es wichtig, Personen mit Beeinträchtigung nicht zu schonen, sondern sie gleichzubehandeln wie die anderen Chormitglieder.
Ich überforderte sie manchmal bewusst in den Proben.
Wie gingen Sie dabei vor?
Ich begegnete allen auf Augenhöhe und ermutigte sie, Versagensängste zu überwinden und mit Freude aufzutreten. Mein Ziel war es, dass sie auf der Bühne im KKL ihre Kraft entfalten und stolz auf sich sein können. Deshalb überforderte ich sie manchmal bewusst in den Proben.
Was waren die grössten Herausforderungen?
Ich musste mein Tempo drosseln und Vertrauen aufbauen – in mein Gegenüber genauso wie in mich selbst, denn ich befand mich ja in einer mir ungewohnten Situation. Anspruchsvoll war auch, die verschiedenen Interessen der Involvierten zusammenzubringen.
Beeinträchtigte Menschen haben eine viel direktere Art.
Wo sehen Sie Unterschiede in Ihrer Arbeit mit dem inklusiven Laienchor und mit professionellen Musikschaffenden?
Ich glaube, ein grosser Unterschied liegt in der Art der Kommunikation. Beeinträchtigte Menschen haben eine viel direktere Art, die mehr über Gefühle und eine nonverbale Verbindung funktioniert. Und genau diese Art der Offenheit täte auch den Personen im professionellen Bereich vermehrt gut.
Leider sehe ich selten, dass Theaterleitungen Personen mit Beeinträchtigung einbeziehen.
Was nehmen Sie aus der TV-Produktion für Ihre persönliche und künstlerische Arbeit mit?
Das dokumentarische Format war neu für mich: Ich agierte nicht wie sonst als Moderatorin, sondern blieb einfach ich selbst im Coaching-Prozess. Es ging nicht um das perfekte Erscheinungsbild. So habe ich gelernt, auch vor der Kamera ungeschminkt aufzutreten und mich nie zu verstellen.
Kultur will das ganze Leben und entsprechend die unterschiedlichsten Menschen abbilden. Wie inklusiv erleben Sie persönlich die Kunstszene?
Leider sehe ich selten, dass Theaterleitungen Personen mit Beeinträchtigung einbeziehen. Ich denke, wir könnten mehr systemische Vermischungen schaffen. Das wäre eine grosse Bereicherung.
Ihr neuestes Projekt nimmt Fragen, was die Gesellschaft unter Norm und Abweichung von der Norm versteht, ebenfalls auf.
Momentan stecke ich gerade in den Proben von «Fascht Normal», einem Musical über eine Familie mit einer bipolar erkrankten Mutter. Es ist kein typisches Musical, sondern behandelt das schwere und gesellschaftlich wichtige Thema der mentalen Gesundheit. Wir sind alle berührt von dieser Geschichte und freuen uns bereits auf die Premiere am 11. April im Zürcher Theater Seefeld. Und im Herbst folgt dann die SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft», die sich nun in der Rohschnittphase befindet.
Das Gespräch führte Tabitha Zimmermann.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke